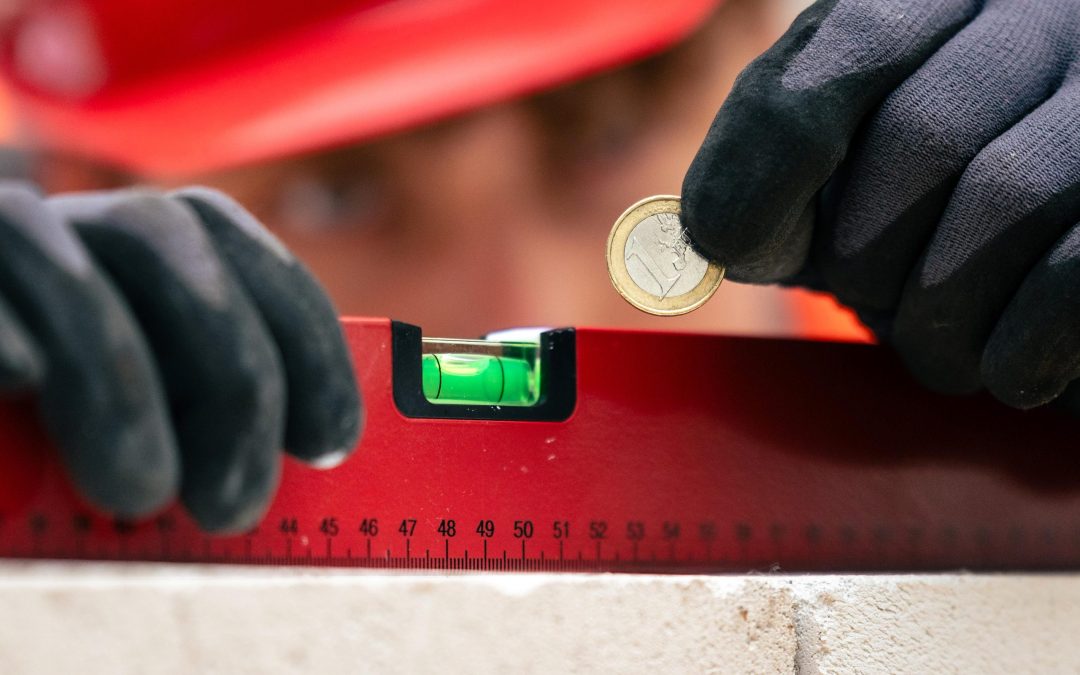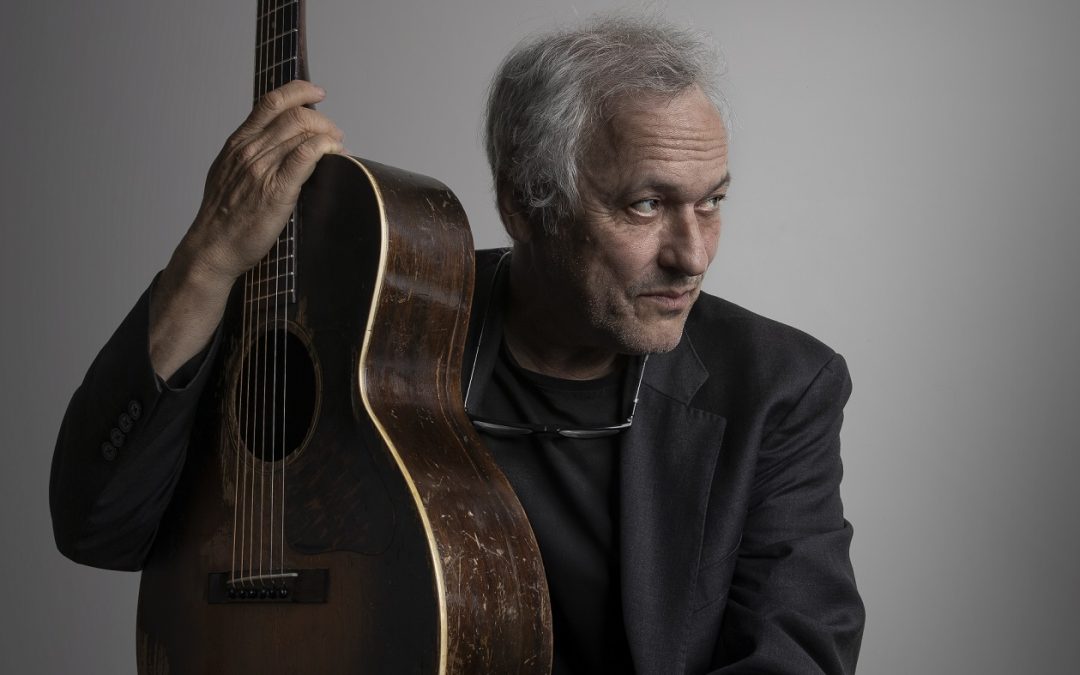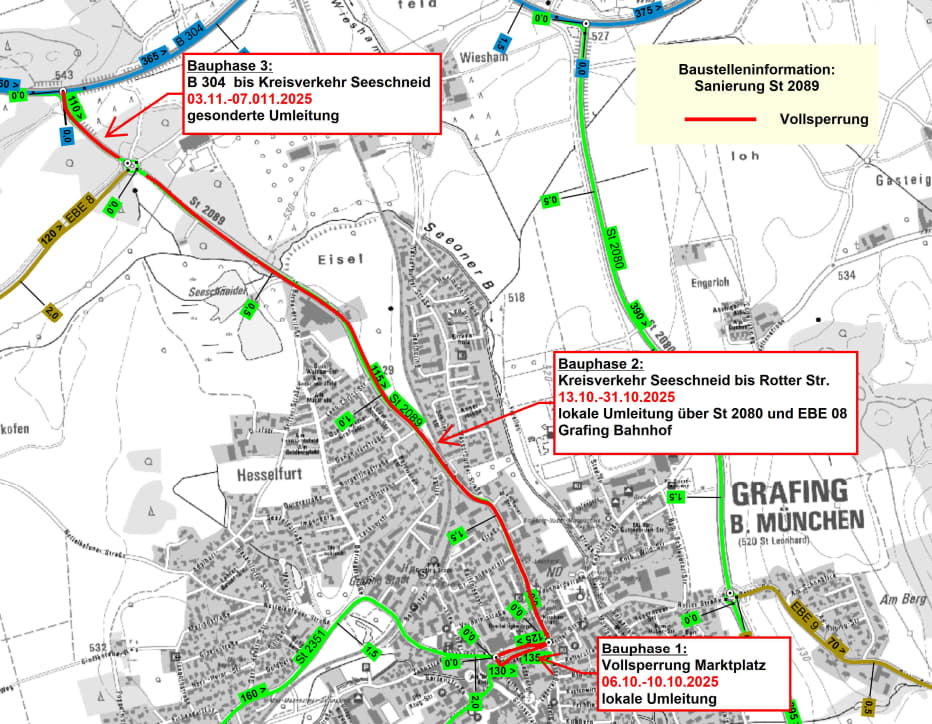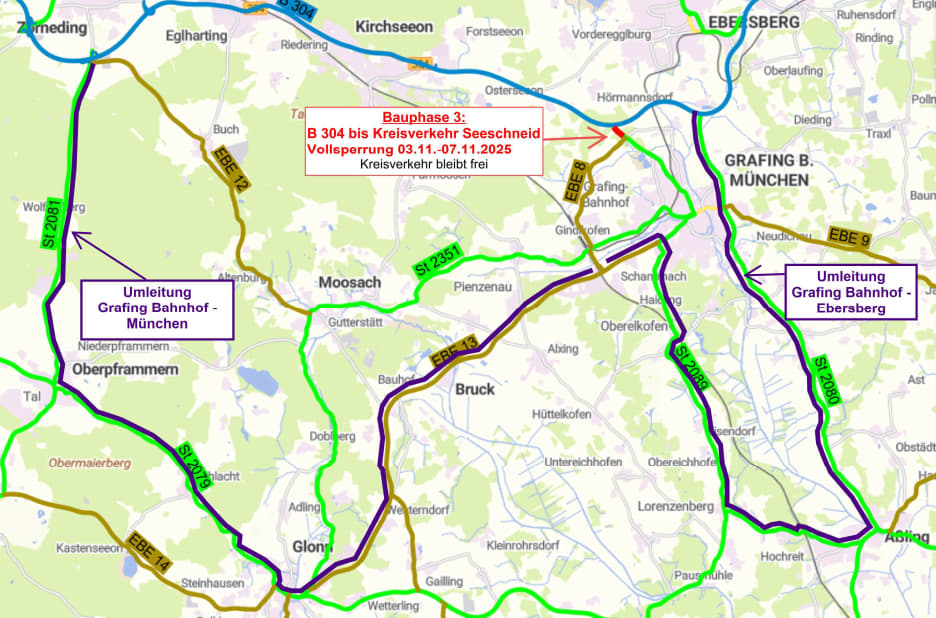Übersicht der Veranstaltungen an der TH Rosenheim
Rosenheim – Die Technische Hochschule Rosenheim hat auch im Oktober wieder einige Veranstaltungen und Workshops. Hier findet Ihr eine Übersicht der anstehenden Veranstaltungen.
1.Oktober – Online-Infoabend zum berufsbegleitenden Masterstudiengang Circular Economy
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: online
Das Klima und die Umwelt schützen, natürliche Ressourcen schonen und gleichzeitig den Industriestandort stärken: Vor diesem Hintergrund bietet die Academy for Professionals der TH Rosenheim am Campus Burghausen den berufsbegleitenden Masterstudiengang Circular Economy an. Kreislaufwirtschaftlich produzierende Unternehmen arbeiten so, dass industrielle Nebenprodukte und umweltschädliche Abfälle wie beispielsweise CO2-Emissionen verringert werden oder am besten gar nicht erst entstehen. Die Kreislaufwirtschaft verbindet Ökologie, Klimaschutz und Wirtschaftskraft. Beim Infoabend werden Aufbau, Ablauf und Inhalte des berufsbegleitenden Studiengangs ausführlich vorgestellt und Fragen beantwortet.
Weitere Informationen und Anmeldung hier.
1.Oktober – „Campus Talk“ in Burghausen zum Thema Halbleitertechnologie
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Campus Burghausen, Marktler Straße 48, Raum B0.03 (Audimax)
Wie entsteht eigentlich ein Computerchip, und welche Rolle spielt dabei ein Siliziumwafer? Dr. Christian Parthey, Vice President für Anwendungstechnik bei Siltronic, gibt spannende Einblicke in die Welt der Halbleitertechnologie. Er erklärt, warum Siliziumwafer die Grundlage moderner Elektronik sind, wie ihre Eigenschaften die Leistungsfähigkeit von Chips beeinflussen und welche technologischen Herausforderungen sich daraus ergeben. Der Vortrag richtet sich an alle Technikinteressierten – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
9. Oktober – Online-Infoabend zum berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und Management
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: online
Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von strategischen und betriebswirtschaftlichen Entscheidungen von Führungskräften, Managern und Mitarbeitenden der Fachabteilungen ab. Diese Kompetenzen vermittelt der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und Management praxisnah und anwendungsorientiert und qualifiziert somit für neue Aufgaben und Herausforderungen. Er ist auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen abgestimmt und richtet sich an Auszubildende mit Abitur sowie berufserfahrene Mitarbeiter mit und ohne Abitur.
Weitere Informationen und Anmeldung hier.
15. Oktober – Infoveranstaltung zur berufsbegleitenden Weiterbildung
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Ort: online
Das Zentrum für Weiterbildung an der Technischen Hochschule Rosenheim bietet ein breites Angebot an wissenschaftlich fundierter, praxisnaher Weiterbildung in der Region. Dies umfasst berufsbegleitende Studiengänge, Zertifikatsprogramme und Seminare sowie maßgeschneiderte Inhouse-Lösungen für Unternehmen und Institutionen. Bei der Informationsveranstaltung werden die Möglichkeiten ausführlich vorgestellt und Fragen beantwortet.
Anmeldung zur kostenfreien Online-Veranstaltung hier.
21. Oktober – Vortrag zum Thema „Gesundheitspolitik – Quo vadis?“
Uhrzeit: 18 bis 20 Uhr
Ort: Campus Rosenheim, Hochschulstraße 1, Raum B 0.23
Die Vortragsreihe Unternehmen und Hochschule, organisiert vom Wirtschaftsverband Seeoner Kreis und der Technischen Hochschule Rosenheim, geht mit dem Thema Gesundheitspolitik in eine neue Runde. Dr. Urlich Schulze, Geschäftsführer des RoMed-Klinikverbunds, beleuchtet den Umbau der deutschen Krankenhauslandschaft. Daran schließt sich eine Podiumsdiskussion an.
Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung hier.
22. Oktober – Online-Infoabend zum berufsbegleitenden Masterstudiengang Circular Economy
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: online
Das Klima und die Umwelt schützen, natürliche Ressourcen schonen und gleichzeitig den Industriestandort stärken: Vor diesem Hintergrund bietet die Academy for Professionals der TH Rosenheim am Campus Burghausen den berufsbegleitenden Masterstudiengang Circular Economy an. Kreislaufwirtschaftlich produzierende Unternehmen arbeiten so, dass industrielle Nebenprodukte und umweltschädliche Abfälle wie beispielsweise CO2-Emissionen verringert werden oder am besten gar nicht erst entstehen. Die Kreislaufwirtschaft verbindet Ökologie, Klimaschutz und Wirtschaftskraft. Beim Infoabend werden Aufbau, Ablauf und Inhalte des berufsbegleitenden Studiengangs ausführlich vorgestellt und Fragen beantwortet.
Weitere Informationen und Anmeldung hier.
23. Oktober – Rosenheimer Vertriebsmeeting zum Thema KI
Uhrzeit: 17:30 bis 21 Uhr
Ort: Sparkasse Rosenheim (Hochhaus), Kufsteiner Straße 1-5
Das Thema KI steht im Fokus des 10. Rosenheimer Vertriebsmeetings, das die TH Rosenheim mit der Sparkasse Rosenheim organisiert. Referenten aus IT, Telekommunikation und Systemgastronomie beleuchten aus verschiedenen Perspektiven, wie Künstliche Intelligenz den Vertrieb revolutioniert, ohne dabei die menschliche Komponente zu verlieren. In der anschließenden Podiumsdiskussion werden die Erkenntnisse gemeinsam vertieft und diskutiert.
Weitere Informationen und Anmeldung (bis 16. Oktober möglich) hier.
28. Oktober – Vortrag zum Thema „Erfolgsfaktor Zusammenarbeit – Unternehmen und Hochschule im Dialog“
Uhrzeit: 18 bis 20 Uhr
Ort: Campus Burghausen, Marktler Straße 48, Raum B0.03 (Audimax)
Wie können Unternehmen in der Region von einer Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Rosenheim und dem Campus Burghausen profitieren? Welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es und wie läuft die Zusammenarbeit ab? Diese und weitere Fragen werden bei der Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe „Unternehmen und Hochschule“ beantwortet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist bis zum 21. Oktober erforderlich.
29. Oktober – Online-Infoabend zum Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: online
Seit dem Sommersemester 2024 gibt es an der TH Rosenheim den berufsbegleitenden Masterstudiengang Nachhaltigkeit im Bauwesen. Er richtet sich an Architekten, Planer und Ingenieure aus den Bereichen Holzbau, Holztechnik, Bau, Baumanagement, Bauwesen oder ähnlichen Gebieten sowie an Führungskräfte für die Bau- und Zuliefererindustrie. Ebenfalls neu ist das einjährige berufsbegleitende Zertifikatsprogramm zu diesem Thema. Bei einem Online-Infoabend werden beide Weiterbildungsangebote vorgestellt und Fragen dazu beantwortet.
Weitere Informationen und Anmeldung hier.
(Quelle: Pressemitteilung TH Rosenheim / Beitragsbild: Symbolfoto re)