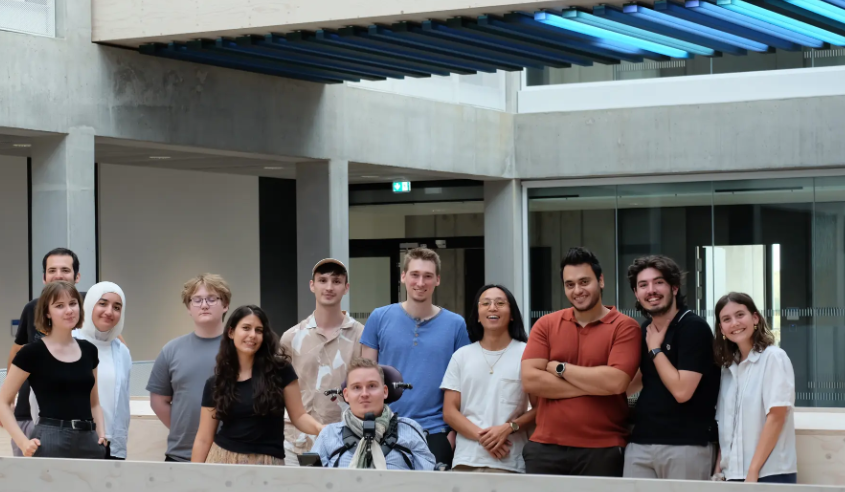320 Millionen Bäume sterben jährlich an Blitzeinschlag
München / Bayern / Deutschland / Welt – Blitze haben einen größeren Einfluss auf Wälder als bisher angenommen. Das haben Forschende der Technischen Universität München (TUM) mit neuen Modellrechnungen gezeigt und erstmals Berechnungen über den globalen Einfluss von Blitzen auf Wäldern vorgelegt. Demnach gehen weltweit jährlich 320 Millionen Bäume in direkter Folge eines Blitzschlags ein.
Blitzschäden in Wäldern sind nur schwer zu erkennen und wurden nur in wenigen Wäldern systematisch untersucht. Wie viele Bäume weltweit jährlich an den direkten Folgen von Blitzeinschlägen eingehen, war daher bislang unbekannt. Ein Forschungsteam der TUM hat deshalb erstmals eine Methode entwickelt, mit der sich zeigen lässt, wie viele Bäume jährlich durch Blitzschlag so stark geschädigt werden, dass sie absterben. Ihre Schlussfolgerung: Der Einfluss von Blitzen auf Wälder wurde bislang unterschätzt.
Während frühere Studien zu den Auswirkungen von Blitzschlag auf der Beobachtung einzelner Wälder basierten, haben TUM-Forschende nun einen mathematischen Ansatz gewählt und auf Grundlage von Beobachtungsstudien und Blitzdaten ein etabliertes Vegetationsmodell erweitert. „Wir können nicht nur abschätzen, wie viele Bäume jährlich durch Blitzeinschläge absterben, sondern auch in welchen Regionen solche Ereignisse gehäuft auftreten und welche Folgen sie für die globale Kohlenstoffspeicherung und Waldstruktur haben“, sagt Andreas Krause, Erstautor der Studie und Forscher an der Professur für Land Surface-Atmosphere Interactions.
Anzahl getöteter Bäume könnte zukünftig noch steigen
Gemäß diesen Berechnungen verursachen Blitze jährlich das Absterben von etwa 320 Millionen Bäumen und sind für 2,1 bis 2,9 Prozent der jährlichen abgestorbenen pflanzlichen Biomasse verantwortlich. Der so verursachte Biomasseverlust setzt global rund 770 bis 1.090 Millionen Tonnen CO2 frei. Solche Zahlen sind laut den Forschenden überraschend hoch und liegen in derselben Größenordnung wie die rund 1.260 Millionen Tonnen CO2, die jährlich bei Vegetationsbränden durch die Verbrennung lebender Pflanzen freigesetzt werden. Der gesamte durch Vegetationsbrände verursachte CO2-Ausstoß ist jedoch höher, da dieser sich zusätzlich noch aus der Verbrennung von Totholz und organischem Material im Boden ergibt und insgesamt rund 5.850 Millionen Tonnen CO2 ausmacht.
„Da die meisten Klimamodelle davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr Blitze geben wird, lohnt es sich, diesem bislang wenig beachteten Aspekt mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, sagt Andreas Krause. „Aktuell ist die Blitzmortalität in den Tropen besonders hoch. Die Modelle gehen aber davon aus, dass die Blitzhäufigkeit vor allem in mittleren und hohen Breiten steigen wird. Blitze könnten also in Zukunft auch in unseren Wäldern eine immer größere Rolle spielen.“
(Quelle: Pressemitteilung Technische Universität München / Beitragsbild: Symbolfoto re)